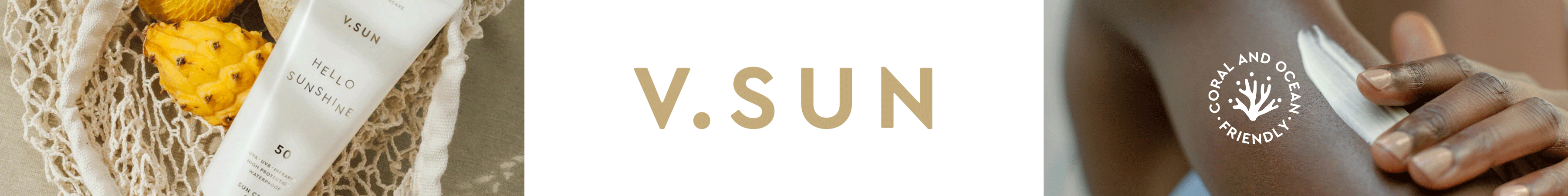Im Herbst vergangenen Jahres sind beim Europäischen Leichtathletik-Verband (EA) und dem Welt-Leichtathletik-Verband (WA) neue Kommissionen berufen worden. Die langjährige DLV-Vize-Präsidentin Dagmar Freitag übernahm in beiden Verbänden wichtige Aufgaben. Im Interview blickt sie auf ihr langjähriges Engagement im Sport zurück und spricht über die Notwendigkeit einer guten Anti-Doping-Agentur und Veränderungsprozessen in der Leichtathletik.
Dagmar Freitag, der Sport, insbesondere die Leichtathletik, sind für Sie offensichtlich weiter eine Herzensangelegenheit, denn Sie waren bereits von 1994 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 2009 bis 2021 waren Sie zudem Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen Bundestages und von 2001 bis 2017 Vize-Präsidentin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Wenn Sie diese Zeit Revue passieren lassen, woran denken Sie besonders gern zurück?
Dagmar Freitag:
Dass ich nach einem erbitterten Kampf mit dem organisierten Sport in Deutschland, der sich über 20 Jahre hinzog, das Anti-Doping-Gesetz unter Dach und Fach bringen konnte. Die in der letzten Wahlperiode erfolgte Evaluierung hat aus der Sicht der damit befassten Sachverständigen deutlich gemacht, dass sich dieses Gesetz mittlerweile bewährt hat. Auch im Ausland war übrigens das Interesse daran groß. So habe ich mit unserem früheren DLV-Präsidenten Dr. Clemens Prokop unter anderem in Neu-Delhi die sportlich und politisch Verantwortlichen über die Kernpunkte unserer Gesetzgebung informiert. Eine besondere Wertschätzung war für mich auch, als ich zu diesem Thema im Kongress der Vereinigten Staaten als Sachverständige referieren durfte.
Was waren sonst noch Highlights für Sie?
Dagmar Freitag:
Auf jeden Fall die Unterstützung der Gründung des Vereins "Athleten Deutschland", der eine vom organisierten Sport unabhängige Interessenvertretung unserer Athletinnen und Athleten ist und überwiegend mit Bundesmitteln finanziert wird. Oder die Unterstützung der Sporthilfe mit Bundesgeldern für die bessere Finanzierung unserer Athletinnen und Athleten sowie der ebenfalls mit Geld aus Berlin begonnene Aufbau einer Alterssicherung. In meiner letzten Wahlperiode habe ich zudem noch die Grundlagen für den Zukunftsplan "Zentrum für Safe Sport" mitgestalten können.
Und ein persönliches Zusammentreffen in New York mit Gretel Bergmann, die zur Zeit der von den Nazis für ihre Zwecke missbrauchten Olympischen Spiele 1936 in Berlin eine deutsche Medaillenhoffnung im Hochsprung war, von Hitler als Jüdin mit perfiden Methoden aber um ihre Teilnahme gebracht wurde. Sie verließ Deutschland und verbrachte den Rest ihres Lebens in den USA, wo ich ihr gemeinsam mit DLV-Präsident Clemens Prokop zu ihrem 100. Geburtstag Glückwünsche vom damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier und dem DLV überbrachte.
Was hätten Sie im Sport noch gerne mitgestaltet?
Dagmar Freitag:
Eine unabhängige, finanziell bestens ausgestattete Sportagentur wie beispielsweise UK-Sport in Großbritannien, auch wenn man nicht alles 1:1 übernehmen kann oder muss. Dort wird alles gebündelt, was den Spitzensport betrifft, und zwar mit erkennbarem Erfolg. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Gründung solch einer Agentur der richtige Weg ist, den Spitzensport in Deutschland wieder erfolgreicher zu gestalten.
Darüber hinaus hätte ich noch gerne an einer durchdachten und wirklich Erfolg versprechenden Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland mitgearbeitet.
Zu Ihren Themenschwerpunkten zählte unter anderem die Bekämpfung des Dopings auf nationaler und internationaler Ebene. Gibt es immer noch Schlupflöcher?
Dagmar Freitag:
Doping ist und bleibt ein Thema, denn es wird immer Menschen geben, die keine Skrupel haben, durch Betrug andere um den verdienten Lohn ihrer Anstrengungen zu bringen. So darf man sicher auch hinter die eine oder andere außergewöhnliche Leistung bei der WM in Budapest ein Fragezeichen setzen. Zudem wissen wir, dass zu Corona-Zeiten längst nicht so engmaschig kontrolliert wurde, wie es wünschenswert gewesen wäre. Es muss daher weiter eine finanziell gut ausstattete Nationale Anti-Doping-Agentur geben und eine Welt-Anti-Doping-Agentur, die ihren Namen auch verdient und nicht unter dem Einfluss des IOC steht.
Bei den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983 in Helsinki gab es für die beiden deutschen Mannschaften 30 Medaillen. In Budapest musste das DLV-Aufgebot ohne Plakette die Heimreise antreten. Wie lässt sich das erklären?
Dagmar Freitag:
Der Blick in die Vergangenheit ist in diesem Fall nicht hilfreich, denn wir wissen ja, unter welchen Bedingungen damals Medaillen gewonnen wurden. Wir erwarten heutzutage von unseren Athletinnen und Athleten, dass sie sauber an den Start gehen und mit dem Begriff "True Athletes", den der DLV ja selbst geprägt hat, für diesen sauberen Sport einstehen. Unsere Athletinnen und Athleten haben in Budapest deutsche Rekorde und zahlreiche persönlichen Bestleistungen erzielt. Die Leistung, die Zehnkämpfer Leo Neugebauer abgeliefert hat, war zudem absolute Weltklasse. Das zeigt, dass der individuelle Trainingsaufbau bei vielen unserer Athletinnen und Athleten durchaus gestimmt hat.
Bei der Null-Bilanz des DLV in Budapest spielt sicherlich eine Rolle, dass sich die Zahl der Länder, die mittlerweile im Medaillenspiegel auftauchen, im Laufe der Jahre ständig erhöht hat, sodass der Verteilungskampf immer größer geworden ist. Aber das allein ist natürlich keine Erklärung. Man muss feststellen, dass die Leistungen unserer Athletinnen und Athleten in einigen Disziplinen bei weitem nicht mehr für Edelmetall reichen, und das nicht erst seit der WM in Eugene. Das muss im DLV gründlich aufgearbeitet werden, denn selbst wenn Malaika Mihambo und Johannes Vetter in Budapest dabei gewesen wären, wäre nicht einmal das eine Garantie für eine Medaille gewesen.
Was muss sich in Zukunft ändern?
Dagmar Freitag:
Ich finde es schwierig, verbandsinterne Prozesse von außen öffentlich zu kommentieren; das verbietet sich aus meiner Sicht insbesondere für diejenigen, die früher mal selbst Verantwortung im Verband getragen haben. Ohne gründliche Analyse der möglichen Fehler-Quellen wird es aber außerordentlich schwierig werden, bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles wieder zu den besten fünf Nationen der Welt zu zählen, wie es DLV-Präsident Jürgen Kessing nach der WM in Budapest als Zielmarke formulierte. Der DLV wird diese Mammutaufgabe aber alleine nicht schultern können. Solange wir nicht final die Frage beantworten, welchen Spitzensport wir in Deutschland haben wollen, wird alles weiterhin Stückwerk bleiben. So wie in den vergangenen Jahren, in denen ich es live miterlebt und auch mitverantwortet habe.
Der DLV hinkt in einigen Disziplinen der Weltspitze weit hinterher. Sollte man da nicht lieber die Fördermittel in den Vereins- oder Schulsport investieren, in der Hoffnung, dass dann das eine oder andere Talent den Weg zur Weltspitze findet?
Dagmar Freitag:
Der Bund ist weder für das eine noch das andere zuständig; wir haben hier aufgrund der föderalen Struktur unseres Landes eine klare Aufteilung zwischen den Bundesländern und dem Bund. Was außer dem Schul- und Vereinssport auch für die Universitäten gilt. Wenn die Bundesländer allein in diesen drei Bereichen ihre Hausaufgaben machen würden, wäre im Bereich Talentfindung/-förderung und Duale Karriere bereits viel gewonnen. Starke Vereine, gute Sportstätten und eine Perspektive beim schwierigen Übergang vom Nachwuchs- in den Aktivenbereich sind die unverzichtbare Basis für einen erfolgreichen Spitzensport. Und an dieser Nahtstelle kommt dann die Förderung des Bundes ins Spiel.
Im DLV beobachten wir, dass unsere Nachwuchsathletinnen und -athleten in den Klassen U18, U20 und U23 auf internationaler Ebene recht erfolgreich abschneiden, diese Erfolge aber bei den Männern und Frauen nicht wiederholen können. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Ursachen?
Dagmar Freitag:
Ein ganz entscheidender Grund ist meiner Meinung nach, dass unsere jungen Athletinnen und Athleten längst nicht immer dort einen Studien- oder Ausbildungsplatz finden können, wo auch ihr Trainingsmittelpunkt ist. Von maßgeschneiderten Angeboten, die auf die speziellen Bedürfnisse junger Spitzenathleten und -athletinnen ausgerichtet sind, ganz zu schweigen. Es liegt also nicht immer nur an den Verbänden oder an den Athletinnen oder Athleten, die sich angeblich nicht mehr genügend quälen wollen.
Es sind oftmals die Begleitumstände, die die jungen Leute dazu zwingen, sich viel zu früh vom Leistungssport zu verabschieden. Wie beispielsweise auch die Sorge, den Lebensunterhalt nicht (mehr) finanzieren zu können. Die Lebenswirklichkeit in unserer Gesellschaft geht ja an den Athleten und Athletinnen nicht vorbei. Und nicht alle können oder wollen in eine Sportfördergruppe bei der Bundeswehr, Polizei oder Zoll. Und wenn wir schon so viel über Geld sprechen: Auch von den milliardenschweren Einnahmen des IOC steht den Athleten und Athletinnen aus meiner Sicht ein entsprechender Anteil zu. Denn sie sind das Herzstück der Marke „Olympische Spiele“.
Bei uns haben sich in letzter Zeit einige Wertigkeiten verschoben. Das Streben nach absoluter Höchstleistung ist nicht mehr so gefragt wie früher. Ist Work-Life-Balance ein Problem für den Spitzensport?
Dagmar Freitag:
Das mag für auch den einen oder anderen im Sport zutreffen, aber wir sollten das keinesfalls verallgemeinern. Wer im Sport oder in einem anderen Bereich hochtalentiert ist, der will in der Regel auch wissen, wo seine persönlichen Grenzen liegen. Und das findet man nur mit Fleiß, Ehrgeiz, persönlichem Verzicht und hartem Training heraus.
Kritik wurde in letzter Zeit an der Teilreform der Bundesjugendspiele geäußert, bei denen in den Grundschulen die Leistungen der Kinder nicht mehr exakt mit Bandmaß oder der Stoppuhr gemessen werden. Befürchten Sie auch da eine Verabschiedung vom Leistungsgedanken?
Dagmar Freitag:
Diese Diskussion finde ich ziemlich überbewertet. Da macht einer wie Hans-Joachim Watzke für den Bereich Kinderfußball ein Fass auf, und das ganze Land regt sich auf. In der Leichtathletik wird jetzt kritisiert, dass beim Weitsprung in der Grundschule nicht mehr die konkrete Weite gemessen wird, sondern in Zonen gesprungen wird. Auch nach dieser Änderung erhält jedes Kind eine Rückmeldung über seine Leistung und kann einordnen, ob es nun besser oder schlechter war als andere.
Um nicht missverstanden zu werden: Persönlich habe ich kein überhaupt Problem damit, Leistungen auch bei Kindern konkret zu erfassen und auch zu werten. Die meisten Kinder wollen sich ohnehin messen, laufen auch in der Freizeit um die Wette. Aber die Welt geht nicht unter, wenn wir die Anfangsjahre im Sport etwas spielerischer und damit vielleicht auch kindgerechter gestalten. Gute Lehrer und Übungsleiter erkennen auch so, ob ein Kind sportlich wirklich talentiert ist, und können es entsprechend fördern.
Im Schulsport fehlt es an ausgebildeten Lehrkräften, was natürlich ein großes Problem ist. Warum interessieren sich so wenige junge Leute für den Lehrberuf?
Dagmar Freitag:
Die Herausforderungen in der Schule haben sich gegenüber meiner Zeit als Lehrerin wesentlich verändert. Die vielen zusätzlichen Aufgaben halten möglicherweise junge Leute von diesem Beruf ab. Wir brauchen aber unbedingt junge und fachlich gut ausgebildete Sportlehrerinnen und -lehrer, die ihre Begeisterung für den Sport in unserer bewegungsarmen Zeit auch auf unsere Kinder und Jugendlichen übertragen. Davon würde auch die Leichtathletik profitieren, die in der Schule vor allem auch wieder den Stellenwert erhalten muss, den sie als olympische Kernsportart verdient.